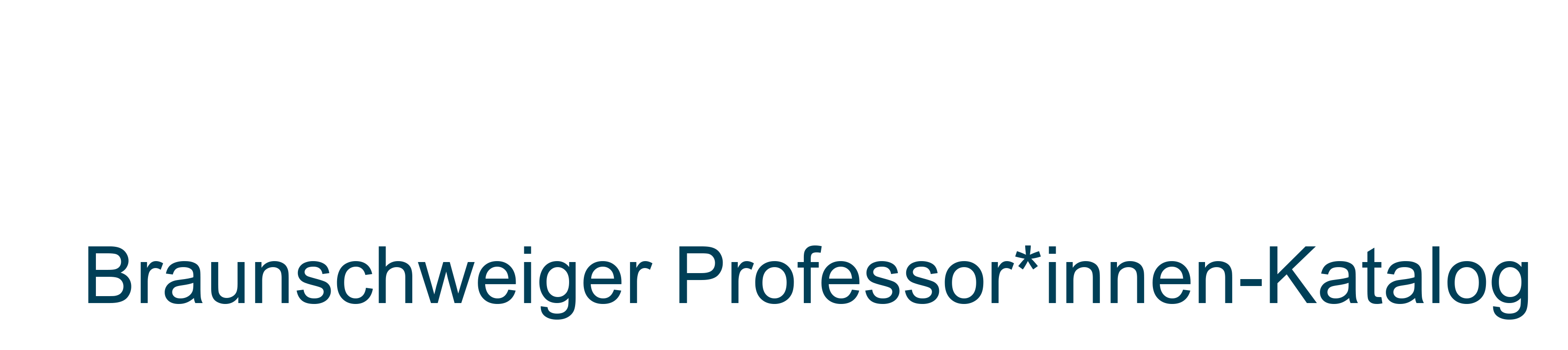| 1946-1968 | Technische Hochschule (1937-1967) |
| 1968-1972 | Technische Universität (seit 1968) |
| Thermodynamik |
| Kältephysik |
| Elektronische Leistungsmechanik |
| Energiedirektumwandlung |
| Brennstoffzellen- und Solar-Technik |
| ab 1912 | Vorschule in Marburg |
| bis 1923 | Besuch des Gymnasiums in Halle an der Saale und in Marburg |
| Studium der Physik, Chemie, Mathematik und Geologie an der Philipps-Universität Marburg, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin | |
| 1929-1944 | Tätigkeit an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin |
| 1939 | Leitung des Kältelaboratorium an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin |
| 1939 | Dozent an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin |
| 1942 | apl. Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin |
| 1944 | o. Professor in Posen (Poznań/Polen) |
| 1945 | Professor für Physik an der Philipps-Universität Marburg |
| 1946 | Nach Einstellung (30.01.1946) dann Entlassung (26.03.1946) vom Dienst an der Herzoglichen Technischen Hochschule Carolo-Wilhelmina Braunschweig |
| 1946 | Wiederberufung (01.09.1946) in den Dienst an der Herzoglichen Technischen Hochschule Carolo-Wilhelmina Braunschweig |
| Promotion | 1929 | Dr. phil bei Eduard Grüneisen an der Philipps-Universität Marburg Titel der Arbeit: "Über die kalorimetrische Absolutmessung des elektrolytischen Leitvermögens für hochfrequenten Wechselstrom " |
| Habilitation | 1935 | für experimentelle, theoretische und angewandte Physik an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin |
| 1953-1954 | Prorektor |
| 1954-1955 | Rektor |
| 1946-1974 | Direktor des Instituts für Technische Physik |
| 1952-1953 | Präsident der Braunschweigischen Gesellschaft für Wissenschaft |
| 1953-1958 | Präsident der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz |
| 1946 | Braunschwegische Wissenschaftliche Gesellschaft (ordentliches Mitglied) |
| 1949 | Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz |
| 1950 | königliche schwedische Ingenieurswissenschaftliche Akademie |
| 1969-1972 | Mitglied des Wissenschaftlichen Prüfungsamtes für die Lehrämter an Gymnasien und Realschulen |
| Eduard Justi gründete das Institut für angewandte Physik der TH Braunschweig und leitete es bis 1974. 1972 erreichte er die Umsetzung der damals einzigartigen Hochmagnetfeld-Anlage an der TU Braunschweig. |
| Eduard Justi entwickelte 1950 einen Motor mit Wasserstoffantrieb. |
| Vorlesungsverzeichnis |
| Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. B07, Nr. 325 (Personalakte). |
| Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. G026 (Nachlass) |
| Deutsche Gesellschaft für Sonnenennergie e. V., Nachruf Eduard Justi, in: Sonnenenergie. Zeitschrift für regenerative Energiequellenund Energieeinsparung. Jg. 12, Heft 1/Februar, München 1987, S. 4 f. (PDF) |
| Nachruf von Franz Rudolf Keßler, in: Jahrbuch der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, 1987, S. 279-282. |
| Alfred Kuhlenkamp, Die Technische Hochschule Braunschweig im Krieg 1939-1945 und im ersten Nachkriegsabschnitt bis 1947, Braunschweig 1976, S. 10, 28, 184, 190. |
| Reinhard Bein, Eduard Justi (1904-1986) Physiker und Hochschullehrer, in: Braunschweiger Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Hrsg. vom Arbeitskreis Andere Geschichte e. V. Braunschweig 2012, S. 140-143. |
| Marie Schlotter, Der Briefnachlass von Eduard Justi - ein bemerkenswerter Bestand für das Universitätsarchiv Braunschweig, in: UBlog, 09.07.2019 |
| Stadt Braunschweig, FB Tourismus und Kongresse, Kulturdenkmale und Persönlichkeiten, Eduard Justi |
|
GND: 117242829
[GND-Link auf diese Seite: https://profkat.tu-braunschweig.de/resolve/gnd/117242829] |